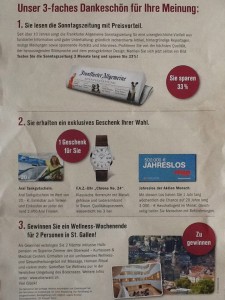Journalisten als Marken
Auf der DLD 13 gab es ein Podium mit Arthur Sulzberger, Jeff Jarvis, Katharina Borchert und Martin Niesenholtz (hier kurz zusammengefasst). Dabei fand ich die Anmerkungen zu den Journalisten als Marken und Werttreiber von Plattformen sehr interessant. Diesen Gedanken „Journalisten als Marken“ möchte ich aufgreifen und ein mögliches Geschäftsmodell für Qualitätsjournalismus und Verlage daraus skizzieren.
1. Personal Brands in den kreativen Berufen
Mit der Unterhaltung sind wir auch mit Berühmtheiten – Celebrities – groß geworden: In Kunst, Literatur, Schauspiel, Film, Musik, Fernsehen usw. bis hin zur Werbeszene und der Haute Cuisine (Lafer und Kollegen). Kurz gesagt: in allen kreativen Berufen spielen Personal Brands und Berühmtheiten die entscheidende Rolle. Dabei haben im Fernsehzeitalter der Shows, insbesondere auch Talkshows, die „Branded Celebrities“ auch hier eine immer gewichtigere Rolle eingenommen. Ihre Shows sind nach Ihnen benannt: Lanz, Jauch, Will, Maischberger, Beckmann oder auch damals noch Kerner oder Schmidt. Sie sind so eine Art Borderliner: Immer an der Grenze zwischen Unterhaltung und Information – manche mehr, manche weniger.
Aber zu diesen Marken haben wir alle einige Vorstellungen, wir verbinden Assoziationen mit Ihnen: gute und schlechte, starke und schwache, direkte und indirekte, leicht abrufbare und einige mit Nachdenken, von manchen haben wir Bilder oder Stimmen im Kopf. Je bekannter, desto mehr und umgekehrt. Das ist das Wesen von Marken: Bekanntheitsgrad und Images als Summe von Assoziationen in unseren Köpfen. Marken sind also nicht nur Autos oder Yoghurts, sondern auch Personen.
Personal Brands kennen wir auch aus dem Journalismus des TV’s: Claus Kleber, Marietta Slomka, Caren Miosga, Jan Hofer, Peter Kloeppel und noch viele mehr. Sie werden als Anchormen/women bezeichnet oder treten als prominente Korrespondenten in Erscheinung. Sie erkennt man wieder, ihnen vertraut eine Mehrheit, ihre Werte respektiert man, an ihnen richtet man sich aus oder auch nicht und ihre Argumente greift man auf. Sie verdienen in den Sendeanstalten am besten und sie ziehen ein Millionenpublikum in ihre Sendungen und die Folgesendungen (Audience Flow). Sie werden transferiert wie Fussballspieler, weil sie für die Sender einen Wert haben: Claus Kleber von der ARD zum ZDF, Sigmund Gottlieb vom ZDF zur ARD, Laura Dünnwald von der ARD zu ProSieben usw. So profitieren beide voneinander – kooperatives Marketing nennt das meine Profession. Diese Marken lassen sich dehnen. Da macht Frank Blasberg halt auch noch Unterhaltungsshows, genauso wie Judith Rakers, oder Reinhold Beckmann moderiert Fußball.
2. Personal Brands im Printjournalismus
Bei den Printmedien kennen wir unter den Journalisten solche Marken eher weniger – ausser innerhalb der Branche natürlich. Bekannt sind dem breiten Publikum dann eher die Chefredakteure: z. B. Giovanni di Lorenzo, Kai Diekmann, Frank Schirrmacher, Georg Mascolo, Kurt Kister, Gabor Steingart etc. über deren Publikationen und gelegentliche Präsenz im Fernsehen. Darin schreiben sie das Editorial, Kolumnen oder auch herausgehobene Essays, Artikel, Kommentare. Von Chefredakteuren abgesehen schaffen nur wenige den Sprung in die Top 500 Intellektuellen laut Cicero. Alice Schwarzer (4), Marcel Reich-Ranitzki (7) und Frank Schirrmacher (10) stehen unter den Top 10.
Viele werden eher unbewusst zu Marken, weil Sie neben der ursprünglichen Aufgabe zusätzlich im Fernsehen moderieren, Bücher herausgeben, bloggen, twittern, als Moderatoren auf Events und in Diskussionsrunden auftreten. Alles in allem aber spielen Personal Brands im Print-Journalismus eher eine untergeordnete Rolle. Warum? Ist die Reichweite ihrer Medien nicht ausreichend? Erkennen Verlage und Protagonisten das publizistische und ökonomische Wirkungspotential der Marke nicht? Ist der Aufbau einer eigenen Marke in journalistischen Kreisen unanständig? Weil Marketing und Journalismus an den jeweiligen Enden einer Achse liegen und das Marketing unter Journalisten anrüchig ist (Ich hasse es, wenn Journalisten von Reklame statt Werbung schreiben, das machen die extra!)? Kollidiert es mit den Grundsätzen journalistischer Ethik?
3. Über den Nutzen von journalistischen Marken / Branded Journalists
Für die Leser haben journalistische Marken aus drei Gründen eine große Bedeutung: Erstens, sie sind bekannt, man kennt ihre Herkunft, sie bieten Orientierung in der Informations- und Meinungsflut, sie erleichtern damit die Informationsaufnahme und sparen Zeit. Darüber hinaus aber reduzieren Sie zweitens das Risiko, falsche oder schlechte Informationen und Beiträge zu lesen. Sie geben also Sicherheit, spenden Vertrauen und das kontinuierlich. Dabei sind journalistische Beiträge Vertrauens- und Erfahrungsgüter. Erst wenn ich sie konsumiert habe, empfinde ich einen subjektiven Nutzen über dessen Qualität, oder sagen wir besser, dessen Beitrag zur Befriedigung meiner Bedürfnisse (Wissen, Identifikation, Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung). Mein Vertrauen in den Verlag muss entsprechend groß sein. Genau das ist ja der Knackpunkt, warum Paid Content Modelle funktionieren oder auch nicht. Ich als Leser brauche Vertrauen in das journalistische Produkt. Genauso wie bei allen anderen kreativen Leistungen. Vertrauen in den Leistungserbringer beschützt mich vor dem „Kauf der Katze im Sack“ weil ich bereits gute Erfahrungen gemacht habe oder weil eine vertrauenswürdige Quelle aus meinem sozialen Umfeld eine entsprechende Empfehlung macht (persönlich oder über soziale Medien). Und drittens schließlich haben Marken im Journalismus auch eine ideelle Funktion: Sie bieten eine Fläche zur Identifikation oder Ablehnung. Entweder möchte man so denken, analysieren oder formulieren wie der Journalist, das ist der Leuchtturm an dem man sich orientiert, oder dieser denkt genauso wie man selbst, das bestätigt das eigene Ego.
Für den Journalisten (und den Verlag oder Blog) hat eine Marke ebenfalls eine hohe Relevanz: Sie generieren Reichweite für das Verlagsobjekt, sie werten die Verlagsmarke auf, sie steigern dessen und die eigene Bekanntheit. Sie kassieren höhere Gehälter, haben bessere Jobchancen – auch als Freie Journalisten, sie schaffen sich eine treue Leserschaft, diese erweitern die Leserschaft durch Word-of-Mouth, Likes, Retweets, Links usw. Und sie bilden damit eine Basis für erweiterte Geschäftstätigkeiten wie Bücher, Vorträge oder Moderationen.
Ich nenne einfach noch einmal ein paar plastische Beispiele für solche journalistischen Marken: Andrew Sullivan, oder Jochen Mai mit seiner Karrierebibel und dessen rund 300.00o Uniquen Usern und ganz bald 20.000 Followern auf Twitter, Holger Schmidt (Focus) ebenfalls mit ganz knapp 20.000 Followern und präsent auf nahezu allen relevanten Content-Plattformen oder schließlich auch mein ehemaliger Handelsblatt-Kollege Thomas Knüwer, dessen journalistische Marke ihm half ein eigenes Unternehmen zu gründen und dem über 27.000 Twitterer folgen.
4. Verlage könnten besser profitieren
Wenn Verlage den Grundgedanken der Musik- bzw. der Tonträgerindustrie aufnehmen und die Grundsätze modernen Marketings beachten würden, dann würden Sie journalistische Marken aufbauen. Auswahl und thematische Positionierung wären in der Verantwortung der Chefredakteure. Die Verlage würden Journalisten beim Relationship Marketing unterstützen durch die Organisation der notwendigen technischen Prozesse (CMS, Social Media, alle Endgeräte etc.), ihnen durch eine Managementorganisation den Rücken freihalten, sie anständig entlohnen, sie zu Stars machen, was die Besten unter Ihnen auch verdient hätten, und so davon in Euro und Cents profitieren. Vom „Branded Publishing House“ zum „House of Branded Journalists“ im Sinne einer sich gegenseitig bedingenden Kooperation. Darauf aufbauend würde dann ein neues Geschäftsmodell entwickelt, weil es völlig neue Spielräume für neue und modifizierte Preismodelle gäbe. Unter das allerphantastischste daran ist: Digitale Welten mit Owned, Earned and Paid Media sind zur Markenbildung hervorragend geeignet, ohne dafür teure Druckereien oder Pre-Press-Technologie zu bauen und Probeabos zu verteilen, um Vertrauen in das Medium zu erhoffen. Und die Leser? Würden wichtigen, relevanten, hochwertigen Journalismus erhalten, für den sie sicher bereit wären zu zahlen, wenn alle ihre Hausaufgaben richtig machen.
Win-Win-Win für Leser, Journalisten und Verlage. Ich werde dieses Geschäftsmodell in weiteren Posts noch konkretisieren. So, jetzt warte ich auf Gegen- oder Rückenwind…