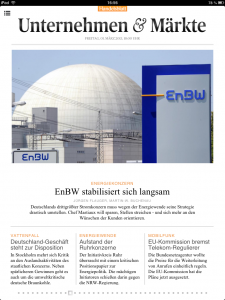Am vergangenen Mittwoch fand in Köln der 5. Tag des Wirtschaftsjournalismus statt. Auch dieses Mal war Gabor Steingart wieder dabei, Herausgeber Handelsblatt und Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt. Also nicht irgendwer. Dabei lies er in Sachen nähere Zukunft des Paid Content für Qualitätsjournalismus in Deutschland einige interessante Bemerkungen fallen. Danach arbeiten führende deutsche Zeitungsverlage an der Einführung einer gemeinsamen Paywall. Wie soll es auch anders sein unter der Führung der Axel Springer AG, die laut Steingart „einen zweistelligen Millionenbetrag“ in die entsprechende Software-Entwicklung investiert habe. Diese soll ein Single-Sign-in ermöglichen, so das Leser zukünftig einfach Angebote verschiedener Publikationen gegen Zahlung beziehen können. Steingart wies in seinen Bemerkungen zu diesem Thema ausdrücklich auf die kartellrechtliche Problematik hin, die eine solche gemeinsame Vorgehensweise mit sich bringe.
Was steckt genau dahinter? In diesem Kontext sollte auch nochmal der Beitrag von Wolfgang Michal auf Carta betrachtet werden. Er schreibt von dem sogenannten Piano-Modell und stellt einen Zusammenhang zwischen der gemeinsamen Anzeigenvermarktung durch das Medienhaus Deutschland und einer nationalen Paywall her. Das glaube ich so in dieser Form derzeit nicht. So heißt es im Handelsregister Düsseldorf zum Medienhaus Deutschland GmbH & Co. KG, das sie „die Vermarktung von nationalen Werbebelegungsmöglichkeiten (u.a. Anzeigen sowie Sonderwerbeformen) in Werbeträgern von Gesellschaftern und von Dritten einschließlich der Abwicklung und Abrechnung der Werbeaufträge sowie damit zusammenhängender Geschäfte zum Gegenstand hat.“
Hinter dem Begriff Piano-Modell steckt das slowakische Unternehmen Pianomedia (siehe dazu auch medienwoche.ch), die sich als Spezialisten für Paid Content bezeichnen. Sie bieten sowohl Software und entsprechende Prozesse für eine verlagsübergreifende (Piano National) als auch eine verlagsspezifische Lösung (Piano Solo) an. Nach der Slowakei und Slowenien ist auch in Polen das Piano-Modell installiert worden.In Polen sind an dem Modell unter anderem auch Ringer Axel Springer sowie die Verlagsgruppe Passau beteiligt. Und eine weitere Expansion in Europa wurde bereits im letzten Jahres angekündigt (auch hier). Entweder stimmt die Aussage Steingarts im Kern, dann hat Axel Springer das Piano-Modell in eine eigene Software gegossen oder man beteiligt sich an Pianomedia oder übernimmt diese gar gleich. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass deutsche Verleger Ihre Revenues mit anderen wie Apple oder Pianomedia auf Dauer teilen wollen. Und auch die direkten Zugänge zu den Kunden werden sie nicht aufgeben. Interessant ist, wie Christoph Keese zu dem Thema Pianomedia keine Stellung bezieht.
Jetzt addieren wir mal 1 und 1 zusammen. Die Zusammenschlüsse und ein gemeinsames Vorgehen deutscher Zeitungsverlage nehmen zu: Medienhaus Deutschland und die Quality Alliance von Verlagsgruppe Handelsblatt, FAZ, SZ und ZEIT kümmern sich um eine gemeinsame Werbevermarktung in Print und Digital. Das Leistungsschutzrecht ist so gut wie durch. Fehlt nur noch eine Einigung oder ein juristischer Sieg mit dem bzw. gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann dürfte zumindest in Deutschland das Thema Free-Content für Qualitätsjournalismus im Wesentlichen bei Spiegel-Online verbleiben, solange die standhaft bleiben.
Ich bin gespannt was das Kartellamt machen wird. Während sowohl Medienhaus Deutschland als auch die Quality Alliance ohne Probleme an den Markt gegangen sind, hat man eine gemeinsame Inhalte-Vermarktung – Video on Demand – der öffentlichen-rechtlichen Sender und zahlreicher Produzenten zunächst mal gebremst. Eine gemeinsame technische Plattform ohne gemeinsame Abrechnung würde dagegen wohl durchgehen. Das könnte dann auch für die Verlage die Lösung sein. Der Politik würde es recht sein.
Paid Content ist und bleibt das Medienthema 2013.
16. März 2013 von Thomas
Kategorien: Bezahlmodell, Geschäftsmodell, Qualitätsjournalismus |
Schlagwörter: Leistungsschutzrecht, Paid Content, Paywall, Qualitätsjournalismus |
Kommentare deaktiviert für Gemeinsame Paywall deutscher Zeitungsverlage?

Der Weg zu einer eigenen journalistischen Marke ist lang. In mehreren Teilen möchte ich den Weg von der geplanten Identität zum wahrgenommenen Image auf Seiten der Leser beschreiben. Dabei beschreibe ich diesen Weg aus der Marketingperspektive und den relevanten Erkenntnissen aus der Neuropsychologie.
Teil 1 (Strategie): Archetypen, Motive und emotionaler Nutzen
Der einfache Weg zur persönlichen Marke wird häufig so beschrieben: Suche dir ein spezielles Themengebiet in dem du dich auskennst, schreibe und blogge darüber regelmäßig und mache das ganze am besten über soziale Medien bekannt. Das ist kurz gedacht und die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt bei 50:50. Mit einer rein inhaltsgetriebenen Positionierung wird unterstellt, dass die Leser ein rationales und kognitiv gesteuertes Informationsbedürfnis haben. Ich will euch da nicht enttäuschen, aber ich glaube, die meisten Konsumenten von Informationen haben eigentlich andere Motive und ein völlig anderes, ein emotionales Nutzenbedürfnis. Darüber sind diese sich aber kaum bewusst. Es läuft unbewusst, subtil und implizit ab, im Autopiloten. Aus der Neuroforschung und von dem renommierten Harvard-Professor Gerald Zaltman wissen wir: mehr als 95% aller Entscheidungen werden von diesem impliziten System getroffen. Nur 5% reflektiert der Pilot bewusst und gedanklich kontrolliert. Warum? Der Mensch musste in seiner Entstehungsgeschichte mit seinen Kräfte immer haushalten. Das hat ihn extrem effizient gemacht. Die unbewusste Verhaltenssteuerung zählt zu diesen Effizienz-Werkzeugen. Ich muss mich hier kurz halten. Interessant in dem Zusammenhang ist die Prize Lecture des Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaftlen, Daniel Kahnemann, 2002.
Der großartige Schweizer Psychologie Carl Gustav Jung hat die Psyche in drei Bereiche eingeteilt: Den persönlich bewussten Verstand, das persönlich Unbewusste und das kollektive Unbewusste. Sie sind als das „psychische Erbe“ den Menschen angeboren. Inhalte des kollektiven Unbewußten sind Archetypen, angeborene und vererbte Tiefenstrukturen der menschlichen Psyche, die sich in mythologischen oder ursprünglichen Abbildungen widerspiegeln. In vielen Mythen, Märchen oder Sagen sind vor allem zwei grundlegende Archtypen vorhanden: Der „Held“, der sich bereit erklärt, das Böse der Welt auszurotten und das „unschuldige Mädchen“, das jung, hübsch und unschuldig von der bösen Stiefmutter misshandelt wird. Den Rest kennt ihr: Siegfried, Achilles, Herkules, Drachen, Prinzen, Aschenputtel, Frösche, Prinzessinnen usw. Kurzum: Männer wie auch Frauen träumen von dadurch geschaffenen Idealbildern. In Filmen wie Casablanca, Terminator, Rocky, Harry Potter, Erin Brokovic, Avatar, Pocahontas oder Pretty Women finden sich diese Archetypen geschlechtsneutral wieder.

In Mythen und Sagen wird das Böse und das Chaos durch den Drachen beschrieben. Der Held kämpft auf unterschiedliche Art mit dem Drachen um das Leben weiter bestehen zu lassen. Der Held repräsentiert die Tugenden. Zwölf (geschlechterneutrale) Heldentypen lassen sich unterscheiden:
- Der Bodenständige (Otto Normalverbraucher): verbündet sich mit anderen in einer Gemeinschaft gegen ihn
- Der Schöpfer (W.A. Mozart): setzt den Drachen nützlich ein
- Der Beschützer (Mutter Theresa): schützt die anderen vor ihm
- Der Herrscher (Gerhard Cromme): zähmt den Drachen
- Der Held (John Wayne): bekämpft und schlägt den Drachen
- Der Rebell (Che Guevara): trotzt dem Drachen
- Der Magier (Harry Potter): verzaubert den Drachen
- Der Liebhaber (Leonardo di Caprio in Titanic): umarmt den Drachen
- Der Narr (Charlie Chaplin): amüsiert den Drachen
- Der Unschuldige (Walt Disney): leugnet den Drachen
- Der Entdecker (Reinhold Messner): sucht nach dem Ursprung des Drachen
- Der Weise (Dalai Lama): studiert den Drachen
Die Motivstruktur von Menschen lässt sich auf drei Grunddimensionen und -bedürfnisse zurückführen (um weiter Leben zu können):
- Erregung einerseits, Disziplin andererseits
- Abenteuer einerseits, Sicherheit andererseits
- Genuss einerseits, Autonomie andererseits
Die Persönlichkeit eines Menschen wird von den Grundbedürfnissen geprägt. Die Helden und Anti-Helden – auch die tragischen Helden – lassen sich wiederum diesen drei Grunddimensionen zuordnen:
- Erregung: Entdecker, Magier, Rebell, Narr
- Sicherheit: Liebender, Unschuldiger, Bodenständiger, Beschützer
- Autonomie: Herrscher, Kämpfer, Schöpfer, Weiser
Die Leser oder Nutzer des Qualitätsjournalismus – also Menschen weltweit – versuchen mehr oder weniger diese jeweiligen Grundbedürfnisse unbewusst und implizit für sich abzudecken. Sie träumen davon, entwickeln Sehnsüchte un streben in ihrem Handeln danach – in der Alltagssprache heißt es dann „Selbstverwirklichung“ und „Glücklich sein“. Auf entsprechende Signale, die diese Bedürfnisse und Sehnsüchte befriedigen, reagieren sie ebenfalls unbewusst und implizit. Signale in Film, Musik oder der Literatur – kurz in allen kreativen Lebenswelten – üben dann ein starke Anziehungskraft und Bindungskraft aus. Das tun auch Medienmarken, auch sie strahlen mehr oder weniger gewollte, glaubwürdige, konsistente und widerspruchsfreie Signale aus. Wo würdest Du „Bild“, „Titanic“, „TAZ“ oder „Landlust“ einordnen? Vielleicht schwerpunktmäßig als „Herrscher“, „Narr“, „Rebell“ und „Liebender“?
Journalisten streben in ihrem Ethos nach den Grundtugenden, sonst wären sie keine Journalisten. Ein Journalist, der sich als Marke entwickeln will, sollte sich an diesen Urmuster für Bedürfnisse und Geschichten orientieren: Welche Leser will er ansprechen? Welche Sehnsüchte will er bedienen? Welchen Heldentypus möchte und kann er ausfüllen? Auf welchem Themengebiet kann er diese Typen dauerhaft bedienen? Auch unter Journalisten gibt es diese verschiedenen Archetypen: Günter Wallraff, der Kämpfer – Stephan Niggemeier, der Kämpfer, aber auch Narr – Frank Schirrmacher, der Entdecker und Weise – Giovanni di Lorenzo, der Beschützer – Kai Diekmann, der Herrscher – Hans Zimpert, der Narr – Hans Leyendecker, der Entdecker usw.
Der erste und wichtigste Punkt bei der Entwicklung einer Markenidentität ist die Entscheidung über die eigene Position: Wie sehe ich mich selber, wie sehen mich andere? Wofür stehe ich und wofür stehe ich ein? Welche Rolle will ich einnehmen? An wen will ich mich richten? Welche Werte und Normen leiten mich? Welche Motive bei meinen Lesern will ich bedienen und belohnen? Welchen emotionalen Nutzen will ich stiften: das Bedürfnis nach Sicherheit, Disziplin und Autonomie oder mehr nach Anregung, Abenteuer und Genuss?
Teil 2 (Planung): Journalistische Spitzenleistungen und Einzigartigkeit – folgt demnächst auf diesem Blog.
08. März 2013 von Thomas
Kategorien: Branded Journalists, Content, Qualitätsjournalismus |
Schlagwörter: Archetypen, Bedürfnisse, Branded Journalists |
Kommentare deaktiviert für Branded Journalists – Identität und Image (Teil 1)
Seit heute mittag ist die neue iPad App des Handelsblatt „Live“ im App Store verfügbar. Noch mit den Inhalten der Wochenende-Ausgabe. Richtig startet sie „live“ dann ab morgen. Ich war ja seit Tagen schon sehr gespannt, wie führende Verlage die Disruption der News Industry und damit auch des Qualitätsjournalismus und Paid Content begleiten werden: are they changing their business, because times change? Dazu gehörte auch das Handelsblatt. Machen wir mal einen Schnellcheck – sozusagen die digitale Version des populären Unboxing.
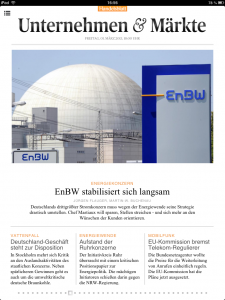
Unternehmen & Märkte vom 1.3.2013
Die App ist mit knapp 12 Mb schnell runtergelassen. Begrüsst werde ich mit viel Orange und dem aus dem Background angestrahlten Handelsblatt Live – sieht schön aus. Dann die Titelseite des Handelsblatts vom vergangenen Freitag. Das Menü startet mit „Übersicht“. Da kann ich mir dann z. B. statt der App auch das E-Paper downloaden. OK, Old Economy, will ich ja nicht. Nächstes Menü „Meine News“: steht natürlich noch nichts drin, deswegen später mehr.
Das Design der Artikelseiten und der Übersichtseiten mag ich ganz spontan. Viel Weißraum, dezenter Farbeinsatz der Hausfarbe, das Layout ist einspaltig mit einer Seitenleiste links, die Serifenschrift ist auch auf meinem alten iPad 2 gut lesbar. Photos stehen in der Regel am Anfang jeden Artikels. Die Seite springt problemlos und schnell von vertikal auf horizontal. Um es kurz zu machen: Was ich schon vermutete, Layout und technische Umsetzung sieht ordentlich aus und es passt zum Handelsblatt wie ich es sonst kenne – vom Chaos der Website mal abgesehen. Werbung ist in der App auch schon. Ganzseitig und interaktiv, d.h. ich kann auf weitere Informationen tippen oder auf die Website weitergehen. Die Werbung stört nicht, sie ist anders als auf der Website oder in der Printausgabe nicht kleinteilig. Das bleibt hoffentlich auch so und das wünsche ich Verlag und IQ digital!
Ich nutze jetzt mal die Personalisierungsoptionen und folge zwei Autoren sowie mehreren Tags, die mir jeweils mit den Artikeln angeboten werden. Unter „Meine News“ werden ich daraufhin beim Menüpunkt „Meine Themen“ mit vielen Beiträgen konfrontiert. Aktuelle Artikel aus der Ausgabe, die gleich redundant auftauchen (vermutlich weil ich Apple und Google getagged habe und die Artikel mit diesen Stichworten nicht überschneidungsfrei sind), aber auch Artikel aus dem Archiv der letzten Tage. Eine Sortierung ist für mich nicht erkennbar. Ich fürchte, wenn ich in einigen Tagen 20-30 Themen-Tags folge, dann ertrinke ich schnell in der Flut. Eine Sortierung wäre also hilfreich. Gleiches bei den Tags nach Autoren. Eine eigene manuelle Indexierung kann ich leider nicht vornehmen, die dann z. B. in einer Abonnenten-Cloud gespeichert wäre. Auch von mir favorisierte Beiträge kann ich nicht mit eigenen Kommentaren versehen, um spontane Gedanken beim Lesen der Artikel zu notieren. Ich muss mir also selbst E-Mails senden, um so diese Aktion umzusetzen. Das ist irgendwie auch so old-ig und vor allem zu aufwendig, also lass ich’s…
Insgesamt beinhaltet die App eine sehr, sehr große Anzahl an einzelnen Beiträgen. Intuitiv vermisse ich eine Führung durch diese Informationsmenge. Der ganze Aufbau und die Leseführung sind so aus dem umblättern der Papierversion gedacht. Einzelne Artikel kann ich auf meine persönliche Merkliste setzen. Oder ich kann einen Artikel weitermailen über das iOS-Mailprogramm. Und da empfinde ich wieder eine ziemliche Enttäuschung. Es gibt keine Sharing-Optionen über soziale Medien, kein Facebook, vor allem kein Twitter, kein G+, ja nicht einmal eine Druckoption über Airprint. E-Mails sind irgendwie auch schon Old Economy. Da keine API’s genutzt werden, gibt es leider keine „most recommended“ oder „most read“ keine Likes, keine Anzahl der Tweets. Auch das ist schade, weil digitaler Journalismus gerade auch von der Vernetzung leben muss. Kommunikation mit den Redakteuren ist auch nur bedingt möglich. So werden zwar zu den Redakteuren E-Mail Kontakte angeboten, die dann gleich mit so einem gestelzten und unkorrekten Text versehen werden: „Sehr geehrter Handelsblatt-Autor Tanja Kewes, ich bin Nutzer der Handelsblatt Live-App und würde Ihnen über diesen Weg gerne ein paar Zeilen senden.“ Geht gar nicht: ich sende Grüße oder schreibe Zeilen und meine Kinderstube würde natürlich die Autorin anschreiben und nicht den Autor. Bitte ersatzlos streichen!
Die „Marktdaten“, also die Börsenkurse, sind anscheinend Realtime, automatisierter Content. Das ist ok, aber es fehlen Fonds, Renten usw. Die kann ich wohl nur über die WKN oder iSIN finden – dazu habe ich jetzt keine Lust…
Das „Infografik-Center“ beinhaltet in dieser Ausgabe eine (1!) Grafik „Rohstoffradar“, anscheinend ein png- oder jpg-Format. Sie lässt sich nicht zoomen oder bearbeiten oder weiterleiten oder drucken, schade.
Um es gehässig zu formulieren: Diese App kostet für 30 Tage knapp 40 Euro. Das ist viel Geld. Das Papier- oder PDF-Format kann ich ich ja mit (digitaler) Schere und (digitalem) Stift bearbeiten, in eine (digitale) Mappe legen oder drucken usw. Diese App hinkt der Papierausgabe technologisch hinterher.
Bei diesem Schnellcheck belasse ich das jetzmal und schaue mir die weitere Entwicklung an. Ich fürchte jedoch, die modernen Regeln des Qualitätsjournalismus für eine moderne Nutzer-Generation – Desintegration und ein offener Prozess – sind mit dieser App kaum zu realisieren. Ich sage dazu mit Clay Christensen „When Time Change, Change your Business“. Oder ich empfehle auch dieses Interview mit Clay Christensen und David Skok über das Nieman Lab.
03. März 2013 von Thomas
Kategorien: App, Bezahlmodell, Content, Geschäftsmodell, Qualitätsjournalismus |
Schlagwörter: Medienzukunft, Paid Content, Paywall, Qualitätsjournalismus, Trends, Verlagsmarketing |
Kommentare deaktiviert für Unboxing: iPad-App Handelsblatt Live
← Ältere Artikel
Neuere Artikel →